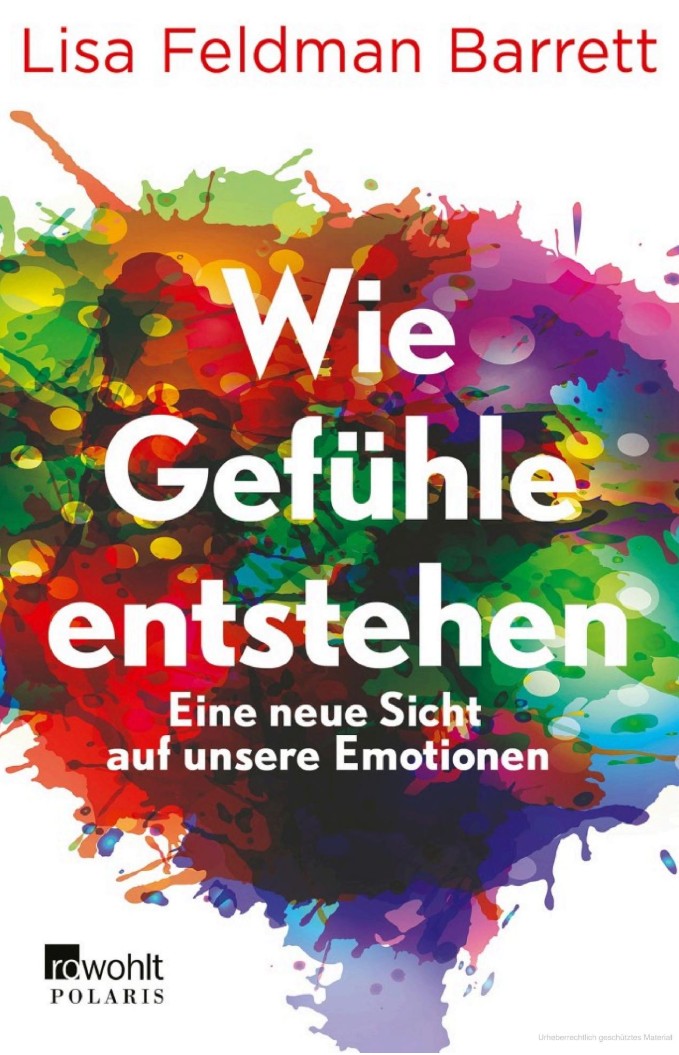
Affektiver Realismus oder eine Rezension des Buches „Wie Gefühle entstehen“
Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, welches mich sehr mitgerissen hat. Es war als Wissenschaftsbuch des Jahres 2024 in der Kategorie Medizin und Biologie nominiert, hat aber leider nicht gewonnen. Nichtsdestotrotz ist es eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe.
Die Autorin, eine amerikanische Kognitions-Psychologin, hat sich mit diesem Buch – meiner Meinung nach – selbst übertroffen.
Sie durchbricht mit diesem Buch einen weit verbreiteten Mythos, der von universellen-Basis-Emotionen ausgeht, sowie von der Einstellung, die davon ausgeht, dass dein Gegenüber Emotionen triggert.
Die Autorin tut kund, dass man selbst der Konstrukteur seiner Emotionen ist und nicht die Umwelt. Meiner Meinung nach ist es ähnlich der „Inside-Out-Theorie“ nach György Buzsáki, allerdings ist hier von einem affektiven Realismus die Rede.
Meist wird von einem Fingerabdruck der Emotionen gesprochen, also universelle Emotionen, die in jedem von uns gleich sind. Ein Beispiel: es gibt verschiedene Ausdrücke von Reue, man kann Reue zeigen, ohne es zu meinen und man kann anders reagieren und trotzdem Reue fühlen. Affektiv würden wir wahrscheinlich dem Menschen recht geben, der die typischen Merkmale von Reue zeigt, aber nicht empfindet. Das ist ein Affekt, also eine unbewusste Vorhersage des Gehirns, die kulturell geprägt ist. Man könnte vielleicht auch sagen, dass es eine konstruierte Realität ist in der wir uns befinden. Wir heißen also etwas für wahr, was wir selbst erschaffen haben, dies aber nicht bewusst wahrhaben können oder wollen.
Diese Realität hat auch in der Welt des Rechts Auswirkung, denn wer Reue zeigt, bekommt in der Regel weniger Strafe, als ein Mensch der keine Reue zeigt.
Wir sind Gefangene eines affektiven Realismus, man glaubt nur das, was seiner Wahrnehmung nach richtig ist, ohne an Fakten interessiert zu sein – einfach aus einem Affekt heraus. Man glaubt fest daran, dass es stimmt, ohne zu zweifeln – wenn es auch Fakten gibt, die das widerlegen.
Wir sehen was wir glauben und nicht umgekehrt!
Kognition, sowie unser Freiheitsgefühl beruhen auf Gewohnheit, also die Idee der Sicherheit, dass wir alles im Griff haben, ist ihrer Forschung nach nicht real, sondern einer Empfindung dessen, da wir es gewohnt sind.
Wir lernen von klein auf gewisse Handlungen und Handlungsweisen als real anzusehen – die für uns alltäglich und somit als einzige Realität angesehen werden – hier beruht aber der Fehler, dass wir glauben rational zu sein.
Es wurde uns rechtgegeben oder irgendjemand hat uns über einige Zeit lang bestätigt – normalerweise übernehmen das die Eltern – so sind wir in den Trugschluss gekommen, dass unser Handeln und Denken „richtig und wichtig“ ist! (Was durchaus legitim ist, da wir aus narzisstischer Sicht dies brauchen, um Selbstvertrauen oder wie es der konservative Pöbel nennt, „Selbstbewusstsein“ zu generieren)
Des Weiteren ist vom Körperbudget die Rede, was diese These untermauert, denn wenn denken nicht rationell ist, dann glauben wir es nicht, da wir uns anstrengen müssten. Das heißt, die Theorie ist nicht intuitiv und deshalb setzt sich die These, dass wir selbst die unsere Emotionen bilden sehr schwer durch.
Einfacher ist es von einem „Trigger“ zu sprechen, also, dass unsere Emotionen von der Außenwelt geprägt werden. Dieses Umdenken, dass wir selbst der Ersteller unserer Emotionen sind, ist ein Widerspruch in uns, den unser Hirn nicht wahrhaben will.
Wie Anna Freud es formulierte, es sind die Abwehrreaktionen des Ichs, welche dies verhindern, den wer will sich schon selbst die Schuld geben. Wir sind weit aus produktiver, wenn wir immer der Außenwelt die Schuld für unser Verhalten geben. Zumindest hat dies subjektiv den Anschein, ob das immer so zutrifft, sei in Frage gestellt.
Es wird die These aufgestellt, dass in unserem Kopf emotionale Konzepte aufgestellt werden, also werden sie in und durch uns generiert und somit lernen wir Vorhersagen zu treffen, die auf Wahrscheinlichkeiten beruhen und desto besser diese zutreffen, desto eher werden sie wiederholt.
Standard-Emotionen existieren nicht, wie wir uns das vorstellen – sie werden in Kinds-Tagen konstruiert und unsere Mutter oder Eltern sowie auch die Umgebung (Schule, Lehrer, Freunde, …) geben uns die Regeln vor, wie wir auf Umstände und Situationen zu reagieren haben.
Vielfalt ist die Norm! Dieser Satz fällt des Öfteren, da er auf die Vernetzung im Hirn zurückgeht. Es ist von interozeptiven Netzwerken die Rede, also neuronale Verbundsysteme, welche im Gehirn Signale über den inneren Zustand wahrnehmen, interpretieren und integrieren.
Somit lerne ich, wie ich meine Bedürfnisse umzusetzen habe: Hunger, Unzufriedenheit … und diverse.
Es ist des Weiteren so gemeint, dass Gefühle konstruiert sind und ein Gefühl, das wir zum Beispiel als Angst definieren bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Es gibt nicht das „eine Gefühl“ welches auf alle Menschen umzuschreiben ist. Es sind verschiedenen Facetten aus unterschiedlichen Gefühlen. Wenn wir ein Gefühl als Angst definieren, dann verallgemeinern wir.
Woher will auch ein fremder oder anderer Mensch wissen, was oder wie ich fühle? Man wendet seine eigenen Emotionskonzepte auf andere Menschen an und glaubt zu wissen, was das Gegenüber fühlt, und nennt es Empathie.
Man muss beim Gegenüber von einer eigenständigen Person ausgehen, welche mit anderer Intelligenz und einer individuellen geburtsmäßigen Ausstattung ausgehen sowie von eigenen Erfahrungen.
Die Autorin bringt auch Beweise aus der Hirnforschung vor, welche unterstreichen, dass zum Beispiel, wenn wir bei Angst bleiben, die Amygdala das „Angstzentrum“ sei. so nicht stimmen kann, wie das in Mainstream-Medien propagiert wird. Denn es gibt hinreichende Beweise, dass die Amygdala mit Nichten nur für die Angst zuständig ist. Vielmehr sind es Vernetzungen im Gehirn, und die sind bei jedem anders, welche „dieses“ Gefühl erzeugen. Es kann also nicht von „der einen Angst“ ausgegangen werden. Es gibt also nicht die eine Angst, sondern sind es feine Verwirrungen, die in jedem unterschiedlich sind, also Emotionen sind feine Nuancen, die es zu interpretieren gilt. Wie Nietzsche es einst kundtat, zuerst ist das Gefühl und die Kognition interpretiert aus der Erfahrung heraus und somit entsteht unsere Realität.
Die Autorin geht sogar so weit, dass sie kund tut, dass das limbische System als funktionelle Einheit, so auch nicht haltbar sei, und so viel ich gelesen habe, auch so nicht beweisbar, da es schon längst Hinweise gibt, dass es so nicht stimmt.
Der Mensch, sowie auch alles andere, unterliegt völlig den Naturgesetzen und somit der Physik – also ist unser Handeln und Denken eigentlich vorgegeben bzw. in wenige Möglichkeiten aufgeteilt. Hierzu möchte ich einen Querverweis auf Niklas Luhmann machen, mit seinem Wegweisenden Buch über die Systemtheorie!
Scheinbar ordnet das Gehirn Erfahrungen in Emotionen um und Wörter übertragen dem Zuhörer Ideen und Konzepte (Metaphern), welche als Vorhersagen (Affekte) interpretiert werden können. Wir kategorisieren und erstellen ein Konzept, welches unser Gegenüber in einen Gefühlszustand umwandeln lässt und uns fähig macht, ihn einzuordnen.
Wörter sind immer Metaphern für einen Gefühlszustand, denn wenn man die Bedeutung des Wortes nicht kennt, kann man deren Aussage nicht erfahren. Es ist immer eine emotionale Erfahrung, die hinter einem Wort steckt, wie zum Beispiel: Freude ist ein subjektiver Ausdruck, hinter dem jeder etwas anderes sieht. Scheinbar erschafft das Gehirn so Bedeutung – zumindest habe ich das so verstanden.
Die Autorin definiert auch sehr viele Krankheitsbilder um, da mit herkömmliche Medikamenten den meisten nicht geholfen, sondern nur eine Abhängigkeit generiert wird.
Auch geht es um emotionale Granularität – also die Fähigkeit seine Gefühle zu erkennen und zu benennen sowie sie zu verstehen, anstatt sie in allgemeine Kategorien wie „gut“ und „schlecht“ einzuordnen. Menschen, die sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen, anstatt sie einfach als gegeben anzunehmen erfahren ein besseres Bewusstsein und können diese auch besser regulieren.
Wir müssen wohl alle einsehen, dass wir einer Illusion erliegen, und zwar der Illusion zu glauben, dass wir andere Menschen verstehen können. Das ist so nicht möglich, denn wir können immer nur von unser eigenen Person ausgehen und übertragen unsere Einstellungen und Emotionen auf andere Personen und sind der festen Überzeugung, dass wir eine psychische Verbindung mit unserem Gegenüber haben. Mag sein, dass es sich so anfühlt, aber die wenigsten ziehen in Erwägung, dass unser Hirn uns hier etwas vorspielt, da es mit Erfahrung und Vorhersagen arbeitet.
Hierzu fällt ein Beispiel aus dem Krankheitsbild der Depression oder Angststörung … bin noch nicht fertig, da kommt noch was!
Genetik: Hasentiere
Das könnte dich auch interessieren

Der Milan ist wieder da!
21. Dezember 2021
Salzburg – eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des Landes und der Stadt
1. März 2022

